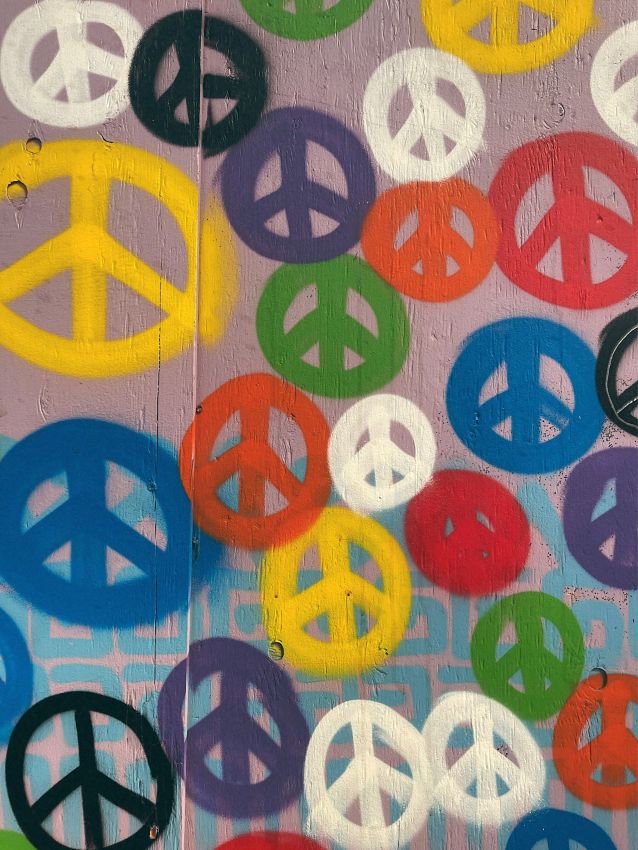Warum wir Friedensarbeit heute dringender denn je brauchen
Die Welt steht an einem Wendepunkt. Globale Krisen verdichten sich, verstärken sich gegenseitig und lassen kaum einen Winkel der Erde unberührt. Klimakrise, Rückschritte in autoritäre Regierungsstrukturen, bewaffnete Konflikte, soziale Ungleichheit, erzwungene Migration, digitale Polarisierung und zunehmende gesellschaftliche Spaltung sind nur einige der Faktoren, die den sozialen Frieden bedrohen – lokal wie global.
Gleichzeitig wächst vielerorts das Bewusstsein: Gewalt ist kein unausweichliches Schicksal. Frieden ist machbar, entsteht jedoch nicht als Selbstläufer. Friedensarbeit umfasst bewusste und strategische Bemühungen, Konflikte nicht zu verdrängen oder eskalieren zu lassen, sondern sie konstruktiv zu gestalten. Es ist ein Berufsfeld, das Brücken baut: Zwischen Menschen, zwischen Perspektiven, zwischen Gegenwart und einer lebenswerten Zukunft.
Was bedeutet Frieden im 21. Jahrhundert?
Frieden wird heute nicht mehr allein als Abwesenheit von Krieg verstanden. Klassischer Antikriegspazifismus – also der Einsatz gegen militärische Gewalt – greift zu kurz, um die komplexen Konfliktlagen unserer Zeit zu erfassen. Frieden im 21. Jahrhundert ist vielschichtig: Er umfasst soziale Gerechtigkeit, politische Teilhabe, ökologische Nachhaltigkeit und kulturelle Anerkennung. Er bedeutet, dass Menschen in Würde leben können – frei von Angst, Diskriminierung und struktureller Gewalt.
Dieses Verständnis orientiert sich am Konzept des „positiven Friedens“, geprägt vom norwegischen Friedensforscher Johan Galtung. Danach ist Frieden nicht nur der Zustand nach einem Waffenstillstand, sondern ein aktiver, gerechter und inklusiver Gesellschaftszustand. Ein Zustand, in dem Konflikte zwar existieren können, aber statt durch Gewaltausübung und durch Beteiligung aller bearbeitet werden. In diesem Sinne ist Frieden kein Zustand, sondern ein fortlaufender gesellschaftlicher Aushandlungsprozess.
Ob in der Ostukraine, im Sudan oder in deutschen Kommunen: Konflikte entstehen dort, wo Ungleichheit herrscht, wo Teilhabe fehlt, wo Traumata unbearbeitet bleiben. Doch Konflikte müssen nicht zwangsläufig in Gewalt münden. Sie können auch Ausgangspunkt für Veränderung und Heilung sein – wenn es Menschen gibt, die professionell begleiten, vermitteln, transformieren.
Eine Zukunft ohne Friedensarbeit? Unvorstellbar.
Wenn wir als globale Gesellschaft die großen Herausforderungen unserer Zeit bewältigen wollen – Klimagerechtigkeit, Migration, Postkolonialismus, Demokratiesicherung – dann brauchen wir Menschen, die vermitteln statt verhärten, zuhören statt zuschlagen, stabilisieren statt spalten. Menschen, die in der Lage sind, Konflikte nicht zu meiden, sondern sie professionell zu transformieren.
Friedensarbeit und Konflikttransformation zählen, wenngleich sie noch sehr junge Tätigkeitsprofile darstellen, somit vielleicht zu den wichtigsten Handlungsfeldern des 21. Jahrhunderts.
Du suchst nach einem Job mit Sinn?
Du suchst nach einem Job mit Sinn?
Friedensarbeit: Was ist das überhaupt?
Friedensarbeit umfasst alle beruflichen und ehrenamtlichen Tätigkeiten, die darauf abzielen, gewaltsame Konflikte zu verhindern, bestehende Spannungen gewaltfrei zu transformieren und nachhaltige Friedensprozesse zu fördern. Im Zentrum stehen Menschenrechte, soziale Gerechtigkeit und der konstruktive Umgang mit Vielfalt und Differenz.
Sie umfasst ein sehr breites Spektrum an Maßnahmen – von Friedensbildung über den Schutz von Menschenrechten bis hin zu Versöhnungsprojekten und Sicherheitspolitik.
Typische Merkmale der Friedensarbeit:
- Sie kann auf verschiedenen Ebenen stattfinden: lokal, national oder international.
- Sie arbeitet sowohl präventiv (z.B. Gewaltprävention, Frühwarnsysteme) als auch reaktiv (z B. Interventionen nach gewaltsamen Auseinandersetzungen).
- Sie ist interdisziplinär: Sozialwissenschaften, Entwicklungszusammenarbeit, Menschenrechte, Psychologie, politische Bildung etc.
- Sie umfasst sowohl strukturelle als auch direkte Maßnahmen, z.B. Förderung demokratischer Institutionen oder Aufbau zivilgesellschaftlicher Netzwerke.
Ein zentraler Bestandteil der professionellen Friedensarbeit ist die Konflikttransformation – ein Ansatz, der nicht nur Symptome von Gewalt adressiert, sondern auf struktureller Ebene Veränderungsprozesse anstößt. Das heißt z.B., bestehende politische Machtverhältnisse zu adressieren, um langfristige Veränderungen anzustoßen, die sich auf die Struktur der gesamten Gesellschaft auswirken.
Zentrale Merkmale der Konflikttransformation:
- Konflikte werden als potenziell konstruktiv verstanden, da sie Missstände, Ungleichheiten oder unterdrückte Bedürfnisse anzeigen.
- Ziel ist nicht nur eine Verhaltensänderung, sondern die Veränderung von Beziehungen, Strukturen und Einstellungen.
- Der Fokus liegt auf partizipativen, langfristigen Prozessen, die die betroffenen Akteur:innen selbst mitgestalten.
Gewalt, wie sie z.B. in kriegerischen Auseinandersetzungen ausgeübt wird, wird dabei als fehlgeleiteter Ausdruck von ungelösten Beziehungs- und Bedürfniskonflikten, etwa zwischen verschiedenen Gruppen, verstanden. Wird die Kommunikation auf die zugrunde liegenden Interessen und Bedürfnisse gelenkt, können gewaltfreie Ausdrucksformen gefunden werden.
Ein bekannter Vertreter dieses Ansatzes ist der US-amerikanische Friedensforscher John Paul Lederach, der Konflikttransformation als „die bewusste Veränderung der sozialen Beziehungen und Strukturen, die einem Konflikt zugrunde liegen“ beschreibt.
Die Transformationsarbeit bewegt sich dabei auf drei Ebenen: Der persönlichen Ebene (z.B. Trauma-Arbeit, Dialog), der Beziehungsebene (z.B. Versöhnungsarbeit, Vertrauensaufbau) und der strukturellen Ebene (z.B. Förderung sozialer Gerechtigkeit, Veränderung von Machtverhältnissen).
Globale vs. lokale Friedensarbeit: Zwei Ebenen, ein Ziel
Friedensarbeit findet auf unterschiedlichen Ebenen statt: Global wie lokal. Während viele zunächst an internationale Einsätze in Krisengebieten denken, wächst zugleich auch die Bedeutung lokaler, oft weniger sichtbarer Friedensarbeit in Städten, Schulen, Gemeinden, Nachbarschaften. Beide Ebenen folgen demselben Ziel: Die gewaltfreie, gerechte Gestaltung von Konflikten. Doch ihre Rahmenbedingungen, Herausforderungen und Dynamiken unterscheiden sich teils grundlegend.
Globale Friedensarbeit: In komplexen Krisenkontexten vermitteln
Internationale Friedensarbeit, etwa im Rahmen des Zivilen Friedensdienstes (ZFD), findet häufig in fragilen Staaten, Nachkriegsgesellschaften oder autoritären Kontexten statt. Fachkräfte unterstützen dort zivilgesellschaftliche Organisationen, fördern Dialog- und Versöhnungsprozesse, stärken Menschenrechtsarbeit oder begleiten lokale Akteur:innen bei Demokratisierungsprozessen.
Dabei bewegt sich globale Friedensarbeit in hochkomplexen Spannungsfeldern:
- Sicherheitsrisiken und fragile politische Strukturen erschweren kontinuierliche Arbeit.
- Es bestehen Sprachbarrieren, kulturelle Unterschiede und asymmetrische Machtverhältnisse, etwa zwischen entsendender Organisation und lokaler Partnerstruktur.
- Immer wieder stellt sich die Frage nach "lokaler Ownership": Wer definiert den Konflikt? Wer bestimmt, was als Lösung gilt?
Kritische Stimmen, insbesondere aus dem Globalen Süden, weisen seit Jahren darauf hin, dass internationale Friedensarbeit nicht selten postkoloniale Muster reproduziert: Externe Fachkräfte, meist aus dem globalen Norden, kommen mit viel Expertise, verfügen aber oft über zu wenig Kenntnis des lokalen Kontextes und der komplexen soziokulturellen Dynamiken.. Wirklich transformative Arbeit entsteht jedoch erst dann, wenn sie gemeinsam mit lokalen Akteur:innen und auf Augenhöhe gestaltet wird.
Lokale Friedensarbeit: Konflikte vor der eigenen Haustür
Auch innerhalb Europas (und ganz konkret in Deutschland) ist Friedensarbeit von wachsender Bedeutung. Hier geht es nicht um bewaffnete Auseinandersetzungen, sondern um gesellschaftliche Spannungen: Polarisierung, Rassismus, Antisemitismus, politische Radikalisierung, Konflikte um Migration oder um Ressourcenverteilung innerhalb von Kommunen.
Beispiele für Formen von lokaler Friedensarbeit:
- Moderation von spannungsgeladenen politischen Beteiligungsprozessen (z. B. Bei großen Bauprojekten oder in kommunaler Demokratieentwicklung)
- Moderation von Dialogformaten in Stadtteilen mit hohem Konfliktpotenzial durch Armut, Gentrifizierung oder kulturelle Spannungen
- Arbeit mit Geflüchteten, die nicht nur rechtlich, sondern auch gesellschaftlich „ankommen“ dürfen
- Bildungsprojekte, etwa gegen Diskriminierung und Ausgrenzung (Friedensbildung)
Programme wie „Kommune und Konflikt“, das Julia Burmann leitet, bieten für kommunale Akteur:innen Konfliktberatungen und Konfliktkompetenzschulungen an. Dadurch werden unterschiedliche Interessen und Perspektiven innerhalb der Stadtgesellschaft sichtbar, was die Erarbeitung konstruktiver Handlungsmöglichkeiten vereinfacht.
Globale und lokale Friedensarbeit stehen nicht im Gegensatz zueinander – sie ergänzen sich. Die Mechanismen von Konflikten ähneln sich oft, auch wenn sie sich in Ausprägung und Eskalationsstufe unterscheiden: Ungleichheit, Ausgrenzung, fehlende Kommunikation und ungleiche Machtverhältnisse sind universelle Konflikttreiber.
Gleichzeitig lassen sich Ansätze aus der internationalen Friedensarbeit produktiv ins Lokale übersetzen, etwa mittels Methoden der Konfliktanalyse, interkulturelle Sensibilität oder partizipative Entscheidungsprozesse. Immer häufiger wechseln Fachkräfte auch zwischen beiden Ebenen: Nach einem Auslandseinsatz bringen sie ihre Erfahrung in lokale Projekte ein – oder umgekehrt.

Aufgabenbereiche: Was machen Friedensfachkräfte konkret?
Die Einsatzgebiete von Fachkräften in der Friedensarbeit sind vielfältig.
Julia Burmann erklärt: “Ein sehr wichtiger Tätigkeitsbereich ist der Zivile Friedensdienst (ZFD) – ein von der Bundesregierung gefördertes Programm für Gewaltprävention, zivile Konfliktbearbeitung und Friedensförderung. Hier arbeiten (internationale) Friedensfachkräfte aktuell in rund 45 Ländern. Aber auch in Deutschland wächst das Feld der demokratischen Konfliktbearbeitung und es werden Menschen mit entsprechenden Kompetenzen gesucht.”
Typische Aufgaben in der Friedens- und Konfliktarbeit sind:
Mediation und Moderation in Konfliktkontexten
Friedensfachkräfte vermitteln zwischen Konfliktparteien, moderieren Dialogprozesse und helfen dabei, gewaltfreie Lösungen zu entwickeln. Die Methoden reichen dabei von klassischer Mediation über zirkuläre Gesprächsformate bis hin zu Großgruppenverfahren.
Beispiel: In einem Nachkriegsgebiet begleiten Friedensfachkräfte Versöhnungsgespräche zwischen verfeindeten Dorfgemeinschaften, um gegenseitiges Vertrauen wiederherzustellen und Rachezyklen zu unterbrechen.
Aufbau lokaler Strukturen für gewaltfreie Kommunikation
Nachhaltiger Frieden braucht stabile, lokale Akteure. Fachkräfte unterstützen zivilgesellschaftliche Organisationen, Schulen oder religiöse Einrichtungen dabei, Strukturen und Fähigkeiten zur gewaltfreien Kommunikation und Konfliktbearbeitung aufzubauen.
Beispiel: In einem multireligiösen Viertel einer Großstadt in Nigeria unterstützt eine Friedensfachkraft ein Jugendzentrum dabei, Peer-Mediator:innen auszubilden und regelmäßige Friedensdialoge zwischen Jugendlichen verschiedener Gruppen zu organisieren.
Dialog- und Versöhnungsprozesse zwischen verfeindeten Gruppen
Ein zentraler Bestandteil vieler Projekte ist die gezielte Förderung von Verständigung, gegenseitigem Zuhören und Verarbeitung von erlebtem Unrecht. Dabei spielen auch kulturelle und spirituelle Elemente eine Rolle.
Beispiel: In Ruanda moderieren Fachkräfte Versöhnungstreffen zwischen Überlebenden und ehemaligen Täter:innen des Völkermords. In begleitenden Workshops wird gemeinsam an Erinnerungskultur und kollektiver Heilung gearbeitet.
Begleitung von gesellschaftlichen Transformationsprozessen
Friedensarbeit ist auch politische Arbeit: Sie unterstützt Prozesse des gesellschaftlichen Wandels, etwa bei Demokratisierung, Dezentralisierung oder Aufarbeitung von Gewaltgeschichte. Dabei kommt es darauf an, Akteur:innen aus Politik, Zivilgesellschaft und Verwaltung miteinander zu vernetzen.
Beispiel: Im Libanon begleitet eine Friedensfachkraft ein Projekt zur Reform lokaler Polizeiarbeit, bei dem Vertreter:innen der Sicherheitsbehörden gemeinsam mit Bürger:innen neue Leitlinien für den Umgang mit Protesten entwickeln.
Trainings in gewaltfreier Kommunikation oder Trauma-Sensibilität
Bildung und Qualifizierung sind Schlüssel zur langfristigen Friedensförderung. Friedensfachkräfte führen Trainings durch, etwa für Lehrer:innen, NGO-Mitarbeitende oder Gemeindevertreter:innen.
Beispiel: In Guatemala organisiert eine Fachkraft ein Training für Frauen, die Opfer häuslicher Gewalt waren, und vermittelt ihnen Methoden der Selbststärkung, Konfliktklärung und kollektiven Interessenvertretung in ihrer Region.
Konfliktanalysen und Projektentwicklung
Bevor ein Projekt startet, analysieren Fachkräfte die gesellschaftlichen, historischen und politischen Rahmenbedingungen eines Konflikts: Wer sind die relevanten Akteure? Welche Interessen stehen sich gegenüber? Welche „Friedensressourcen“ gibt es bereits vor Ort?
Beispiel: Im Vorfeld eines Projekts im Südsudan führt eine Friedensfachkraft Interviews mit lokalen Stammesführern, NGOs, Fraueninitiativen und Vertreter:innen des Bildungsministeriums, um ein konflikt- und kultursensibles Bildungsprogramm zu entwickeln.
Organisationsberatung und Kapazitätsaufbau
Viele lokale Partnerorganisationen haben großes Engagement, aber oft wenig institutionelle Stabilität. Fachkräfte helfen beim Aufbau von Organisationsstrukturen, bei der Entwicklung von Monitoring- und Evaluationssystemen oder bei der Professionalisierung von Programmen.
Beispiel: In Palästina berät eine Friedensfachkraft eine Frauenrechtsorganisation beim Aufbau eines strategischen Wirkungsmonitorings und begleitet sie bei der Beantragung internationaler Fördermittel.
Demokratiearbeit und politische Bildung (besonders im Inland)
Auch innerhalb Deutschlands wächst die Bedeutung friedensfördernder Arbeit – etwa im Bereich der politischen Bildung, der Arbeit mit geflüchteten Menschen oder kommunaler Konfliktberatung. Hier geht es oft darum, gesellschaftliche Spaltungen zu überwinden, Beteiligung zu fördern und Radikalisierung vorzubeugen.
Beispiel: Im Rahmen des Pro-Peace-Programms „Kommune und Konflikt“ begleiten Fachkräfte kommunale Entscheidungsträger:innen und lokale Initiativen dabei, konstruktiv mit Konflikten, z.B. im Kontext von Migration oder Strukturwandel umzugehen.

Arbeitsalltag: Vielseitig, interkulturell und herausfordernd
Der Berufsalltag von Friedensfachkräften ist stark abhängig vom jeweiligen Kontext: Im Auslandseinsatz im Globalen Süden bedeutet er häufig Projektarbeit in enger Abstimmung mit lokalen Partnerorganisationen – mit allem, was dazu gehört: Spracherwerb, kulturelles Einfühlungsvermögen, Sicherheitsmanagement, Organisationsentwicklung. In Deutschland wiederum kann der Arbeitsalltag eher aus Netzwerk- und Beratungsarbeit bestehen, wobei Prozessbegleitung und Arbeit mit Partner:innen sowohl im Ausland als auch im Inland stattfindet.
Grundsätzlich gilt: Der Arbeitsalltag ist äußerst vielseitig, teils schwer vorhersehbar und erfordert eine ausgeprägte Anpassungsfähigkeit. Konfliktverläufe sind dynamisch, politische Konstellationen volatil – entsprechend flexibel und vorausschauend muss gearbeitet werden.
Einstieg und Qualifikationen
Der Weg in die Friedensarbeit ist selten gradlinig, doch genau das macht das Berufsfeld so vielfältig. Die Branche lebt von interdisziplinären Erfahrungen und vielfältigen Perspektiven. Dementsprechend bietet das Arbeitsfeld für Menschen mit unterschiedlichen fachlichen Hintergründen Einstiegsmöglichkeiten.
Grundsätzlich lassen sich zwei Qualifizierungsstränge unterscheiden:
Akademische Ausbildungswege
Akademische Studiengänge bieten theoretisch fundierte Grundlagen zu Konflikttheorie, internationalen Beziehungen, Menschenrechten und sozialem Wandel. Sie sind besonders geeignet für Menschen, die langfristig in Forschung, internationaler Programmarbeit oder politischer Beratung arbeiten möchten.
Folgende beispielhafte Studienfächer legen eine passende akademische Grundlage für eine Tätigkeit als Friedensfachkraft:
- Friedens- und Konfliktforschung:
- Internationale Beziehungen / Internationale Politik
- Politikwissenschaften
- Soziale Arbeit oder Pädagogik mit interkulturellem Schwerpunkt
- Human Rights / Humanitäres Völkerrecht
- Psychologie
- Religionswissenschaft / Theologie (mit Fokus auf Dialogarbeit)
Wichtig: Theorie ist wichtig – aber ohne Praxis kaum aussagekräftig. Viele Organisationen achten auf den Mix aus akademischem Wissen und praktischer Erfahrung.
Praxisnahe Qualifizierungswege
Wer bereits früh den direkten Praxisbezug sucht oder Berufserfahrungen in einem relevanten Feld mitbringt (z.B. Soziale Arbeit, Bildung, Entwicklungszusammenarbeit), kann sich durch gezielte Weiterbildungen in Richtung Friedensarbeit qualifizieren.
Die Akademie für Konflikttransformation gehört zu den renommiertesten Weiterbildungsinstitutionen für Fachkräfte im Bereich der zivilen Konfliktbearbeitung. Julia Burmann beschreibt das Weiterbildungskonzept wie folgt:
“Die Akademie für Konflikttransformation, welche Teil der Friedensorganisation Pro Peace ist, bietet Weiterbildungen und Trainings für Fachkräfte an, die bereits in der Friedensarbeit oder einem angrenzenden Feld tätig sind oder sich beruflich in diese Richtung entwickeln wollen. Dabei profitieren unsere Kurse davon, dass die Teilnehmenden ganz unterschiedliche berufliche Erfahrungen, z.B. aus der Sozialarbeit, aus Behörden oder der Menschenrechtsarbeit mitbringen und das Lernen vor allem auch durch Austausch passiert. Denn neben der Vermittlung von Konzepten und Methoden geht es in unseren Trainings vor allem auch um Selbstreflexion, Rollenverständnis und Handlungsfähigkeit im Kontext von Konflikten.”
Ergänzend sind folgende Weiterbildungen hilfreich:
- Mediation und Konfliktmanagement
- Gewaltfreie Kommunikation (GFK)
- Projektmanagement (insbesondere PMEL: Planning, Monitoring, Evaluation and Learning)
- Trauma- und Sensibilitätstrainings
- Sicherheitstrainings für Auslandsaufenthalte
Entscheidend ist neben der fachlichen Qualifizierung auch die praktische Erfahrung: “Für eine Mitarbeit im Zivilen Friedensdienst sind eine abgeschlossene Ausbildung, mehrjährige Berufserfahrung in einem relevanten Arbeitsfeld sowie eine Reihe sozialer Kompetenzen erforderlich. Praktische Erfahrungen in Krisenregionen oder ehrenamtliches Engagement können oft entscheidend für den Einstieg in die Friedens- und Konfliktarbeit sein. Letztendlich ist aber am wichtigsten, welche Kompetenzen im Projekt erforderlich bzw. von der Partnerorganisation erwünscht werden.”, so Julia Burmann.
Eine gute Quelle für erste Informationen ist laut Julia Burmann z.B. das Orientierungsseminar der Akademie für Konflikttransformation: „Unser Seminar bietet nicht nur einen Einblick in die vielseitigen Tätigkeiten und Einsatzmöglichkeiten von Friedens- und Konfliktberater:innen im Rahmen des ZFD, sondern stellt auch Weiterbildungsmöglichkeiten vor.“
Insbesondere für junge Menschen interessant: Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) bietet gemeinsam mit der Diözese Rottenburg-Stuttgart jungen Menschen (bis 27 Jahren) die Möglichkeit, in verschiedenen Ländern im Rahmen eines einjährigen Freiwilligeneinsatzes erste Erfahrungen im Bereich des Weltfriedensdienstes zu machen.
Mögliche Arbeitgeber
Typische Arbeitgeber sind neben internationalen NGOs vor allem die neun Trägerorganisationen des Zivilen Friedensdienstes:
- Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden (AGDF)
- AGIAMONDO
- Brot für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst
- Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
- EIRENE – Internationaler Christlicher Friedensdienst
- KURVE Wustrow – Bildungs- und Begegnungsstätte für gewaltfreie Aktion
- peace brigades international (pbi)
- Pro Peace
- Weltfriedensdienst (WFD)
Auch sonstige Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit, humanitäre Hilfswerke oder kirchliche Träger (z.B. Brot für die Welt, missio, Justitia et Pax, Coworkers, Verein für Friedensarbeit im Raum der EKD e.V.) sind wichtige Arbeitgeber. Zudem sind viele Fachkräfte freiberuflich als Trainer:innen, Mediator:innen oder Berater:innen tätig.

Persönliche Kompetenzen: Zu wem passt der Job?
Neben reinem Fachwissen sind in der Friedensarbeit darüber hinaus bestimmte persönliche Kompetenzen und Soft Skills gefragt. Julia Burmann sagt dazu “In der Friedens- und Konfliktarbeit sind persönliche Kompetenzen wie Empathie, Reflexions- und Lernfähigkeit, Bewusstsein für Machtverhältnisse sowie ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten entscheidend, um in komplexen und konfliktiven Kontexten zu arbeiten und unterschiedliche Perspektiven einbeziehen zu können. Geduld und Durchhaltevermögen sind wichtig, um prozessorientiert an nachhaltigen Wirkungen arbeiten zu können.”
Zudem betont sie die mentalen Anforderungen des Berufs: “Ebenso sind Resilienz und Stressmanagement von enormer Wichtigkeit, da ein Einsatz als Friedensfachkraft sehr belastend sein kann. Bei Pro Peace haben wir ein starkes Unterstützungsnetzwerk aufgebaut und arbeiten eng mit Coaches zusammen, um Mitarbeitende eng zu begleiten.“
Auslandseinsatz & Rückkehr: Wie läuft das ab?
Die Vorbereitung auf einen Auslandseinsatz erfolgt in der Regel in Deutschland – etwa durch Sprachkurse, landesspezifische Schulungen und Sicherheitstrainings. „Die Vorbereitungszeit dient je nach Bedarf der Fachkraft dem Erwerb von Sprache, der Vertiefung zu Aspekten der Konflikttransformation sowie der persönlichen Vorbereitung auf den Entwicklungsdienst in einem speziellen Land“, so Julia Burmann.
Von ihrem Auslandsaufenthalt bringen die Fachkräfte wertvolle und gefragte Kompetenzen zurück. “Einige Rückkehrende kehren in ihren alten Job zurück oder setzen ihr Engagement im Zivilen Friedensdienst in einem anderen Land oder bei einem anderen Träger fort. Die Expertise, die bei einem Auslandseinsatz erworben wurde, kann aber auch für Arbeitsfelder in Deutschland, z.B. die Arbeit mit Geflüchteten oder die Begleitung von Transformationsprozessen in deutschen Kommunen von großer Relevanz sein.”, so Burmann.
Gehalt und Vergütung
Die Frage nach der Vergütung im Friedensdienst lässt sich nicht pauschal beantworten. Friedensfachkräfte im Zivilen Friedensdienst gelten als Entwicklungshelfer:innen und erhalten daher kein Gehalt im klassischen Sinne. Stattdessen gibt es ein Unterhaltsgeld, das vom Einsatzland abhängt und durch Leistungen wie Familienzuschläge oder Führungszulagen ergänzt wird.
Tatsache ist, dass ein Einsatz im Friedensdienst keine überdurchschnittlich hoch bezahlte Tätigkeit darstellt, dafür aber umso sinnstiftender sein kann. Wer in diesem Feld arbeitet, tut das in erster Linie aus Überzeugung.
Ein persönlicher Werdegang: Julia Burmann
Julia Burmann hat durch einen Quereinstieg ihren Weg in die Friedensarbeit gefunden: “Ich war ca. 15 Jahre lang in der internationalen Programmarbeit und Kinderrechtsarbeit tätig. Hier konnte ich viele Erfahrungen in den Bereichen Programmentwicklung und Teamführung sammeln, die nun in meiner aktuellen Position wertvoll für mich sind. Daneben hat es mich gereizt, mich mit dem Eintritt in die Friedens- und Konfliktarbeit inhaltlich breiter aufzustellen und gleichzeitig weiter an dem Ziel, eine gerechtere und friedlichere Zukunft für alle zu gestalten, arbeiten zu können.”
Heute leitet sie die Akademie für Konflikttransformation, welche Teil der internationalen Friedensorganisation Pro Peace ist. Neben der Programmarbeit im Konfliktkontext und dem Einsatz für nachhaltige Friedenspolitik leistet die Akademie mit der professionellen Weiterbildung einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Ziele der Gesamtorganisation. Seit 2023 leitet sie daneben auch das Programm „Kommune und Konflikt“, das kommunale Entscheidungsträger:innen und weitere Schlüsselakteure im konstruktiven Umgang mit Konflikten unterstützt. Die Verbindung von strategischen und Managementaufgaben und dem direkten Kontakt zu den Menschen, die sich aktiv für Konflikttransformation und Frieden einsetzen, macht ihr besonders viel Freude.
Fazit: Ein Berufsfeld mit Sinn, Verantwortung – und Herausforderungen
Wer sich für Gerechtigkeit, gewaltfreie Konfliktbearbeitung und gesellschaftlichen Wandel einsetzen möchte, findet in der Friedensarbeit ein anspruchsvolles und gleichzeitig bedeutungsvolles Betätigungsfeld, in dem der positive Impact der eigenen Arbeit unmittelbar erlebbar wird. Wichtig sind dabei nicht nur solides Fachwissen, sondern vor allem Kommunikationsgeschick, Lernfähigkeit, interkulturelle Kompetenz – und ein langer Atem.
Informationen zu konkreten Stellenangeboten im ZFD findest du hier.
Online-Event: Arbeitgeber-Insight: Friedensarbeit & Konflikttransformation
Du möchtest noch tiefere Einblicke in das Berufsfeld und im persönlichen Gespräch deine Fragen stellen sowie Arbeitgeber im informellen Rahmen kennenlernen?
Dann trag dir schon einmal den 📅 16.09.2025 ab 12:30 Uhr dick im Kalender ein und melde dich zur digitalen "Spinn.Bar" zum Thema Friedensarbeit an. Diese veranstalten wir in Kooperation mit unserem Partner Spinnen-Netz, dem beruflichen Netzwerk für Arbeit im Non-Profit-Bereich.
Wir freuen uns, Impulsgebende von Pro Peace und EIRENE aus dem Bereich der Friedens- und Konfliktarbeit begrüßen zu dürfen.
Die Teilnahme ist kostenlos, allerdings sind die Plätze begrenzt.